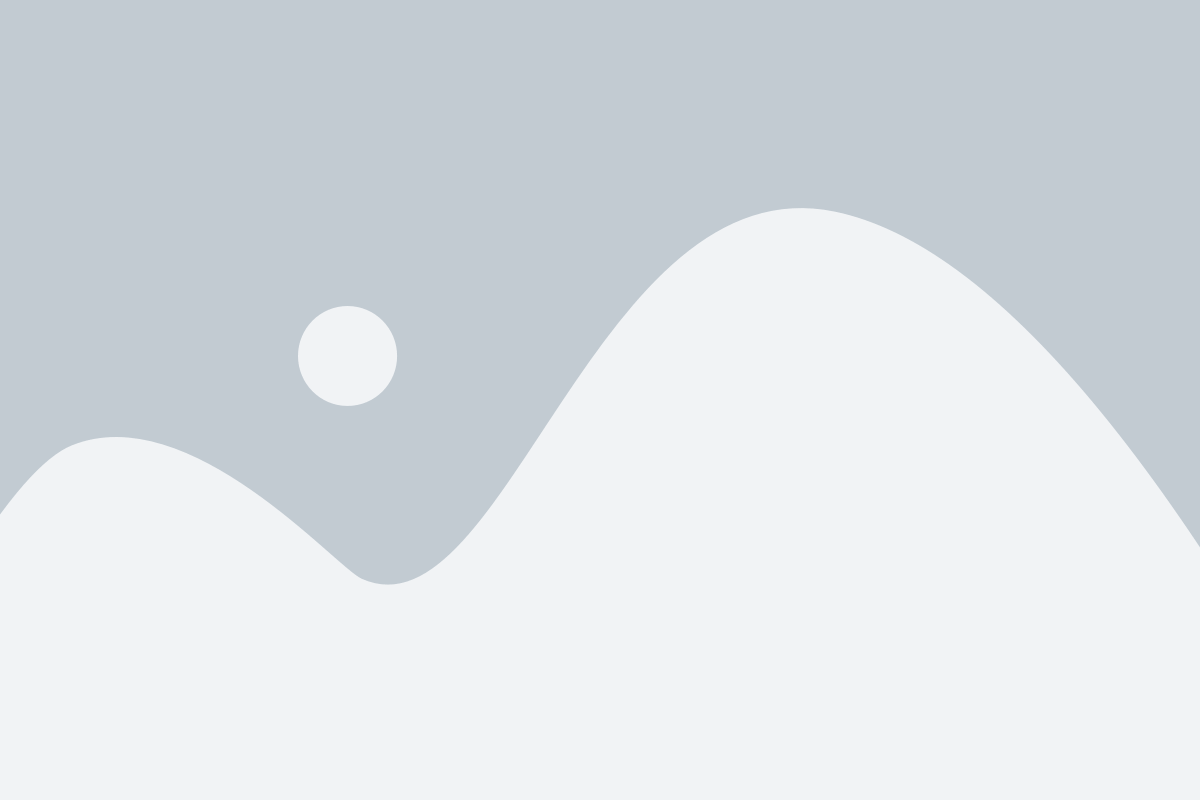Ursprünge im Licht: Frühzeit und Antike
In der Antike mischten Handwerker Quarzsand, Natron und Pflanzenasche, schmolzen alles in Tiegeln und erzeugten das erste klare Fensterglas. Farbigkeit entstand durch Metalloxide, zufällig entdeckt, dann gezielt verfeinert – ein chemischer Zauber im frühen Feuer.
Ursprünge im Licht: Frühzeit und Antike
Schon spätantik verband man kleine Glasscheiben mit Bleiruten, um größere Flächen zu realisieren. Das Material war weich, leicht formbar und dichtete zugleich ab – ein praktischer Vorläufer der späteren Meisterwerke in Kirchen und Hallen.